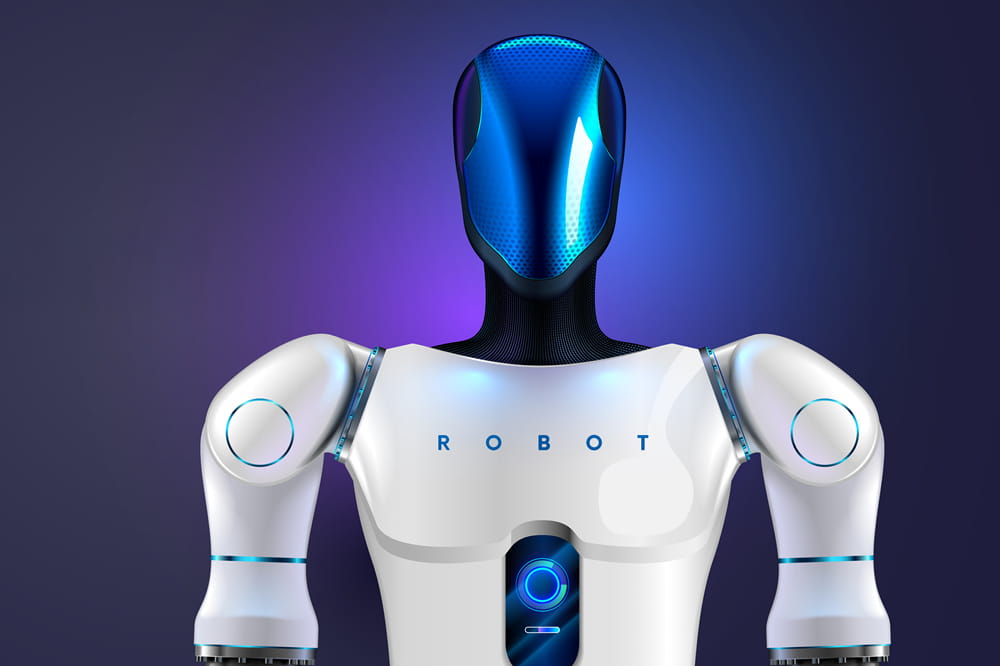Neuigkeiten und Hintergründe aus der Dichtungstechnik erfahren, innovative Produkte kennenlernen – im kostenlosen E-Mail-Newsletter von Freudenberg Sealing Technologies.

Treibhauseffekt rückwärts
Noch entweicht es den Schornsteinen von Industrie und Kraftwerken und belastet das Klima. Doch schon in wenigen Jahren wird CO2 ein begehrter Rohstoff sein, der fossile Ressourcen wie Erdöl ersetzt. Denn CO2 enthält Kohlenstoff, das Rohmaterial für Kunststoffe.
Ein kleiner elastischer Faden könnte zur Revolution für die Textilindustrie werden. So sehen es jedenfalls Professor Pavan Manvi von der RWTH Aachen und sein Forscherkollege Jochen Norwig von der Bayer-Tochter Covestro. Anfang Juli 2019 meldeten sie einen Durchbruch: In ihren Laboren in Krefeld-Uerdingen gelang es ihnen, einen elastischen Faden für die Textilindustrie auf CO2-Basis herzustellen. Wenn sich dieser Faden großtechnisch produzieren ließe, wäre das keineswegs eine Nischenentwicklung: Synthetikfasern müssten dann nicht mehr auf Erdölbasis hergestellt werden, sondern dies wäre dann unter Einsatz von CO2 möglich, das beispielsweise durch Rauchgaswäsche aus den Abgasen von Kraftwerken gewonnen oder sogar direkt aus der Luft herausgefiltert wird. Treibhauseffekt rückwärts sozusagen.
Covestro hat bereits bewiesen, dass sich das Verfahren großtechnisch realisieren lässt. Die Bayer-Tochter arbeitet mit dem Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen und mehreren Textilherstellern schon an einem Produktionsverfahren im industriellen Maßstab. „Aus den Fasern sollen in einem ersten Schritt Strümpfe und medizinische Textilien hergestellt werden“, kündigt Covestro-Sprecher Sergio de Salve an.
"Cadyon" für guten Schlaf
Im Bayer-Werk in Dormagen bei Leverkusen wird ein neuartiges Polyol mit dem Markennamen „Cardyon“ produziert, das einen CO2-Anteil von 20 Prozent aufweist. Das Polyol ist eine zentrale Komponente zur Herstellung weicher Polyurethan-Schaumstoffe, die beispielsweise in Matratzen zum Einsatz kommen. Hier hat Covestro schon die Marktreife geschafft: So nutzt das belgische Unternehmen Recticel den Rohstoff, um daraus Schaumstoffe herzustellen, und vermarktet die Matratzen in Deutschland unter dem Markennamen Schlaraffia. Seit 2016 produziert Covestro jährlich 5.000 Tonnen Polyol. Das Unternehmen arbeitet auch an neuen Anwendungen der Schäume, unter anderem im Fahrzeugbau und zur Herstellung von Dichtungen.
Aus den Fasern entstehen Strümpfe und medizinische Textilien.
Sergio de Salve, Site Communication, Covestro Deutschland AG



Sogar Kunstrasenplätze lassen sich mit CO2 als Rohstoff herstellen. In Krefeld wurde im Oktober 2018 auf dem Gelände des Hockey-Bundesligisten und Europapokalsiegers Crefelder Hockey und Tennis Club (CHTC) ein solcher Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Auf der Anlage werden sogar Heimspiele der deutschen Hockey-Nationalmannschaft ausgetragen. Das Besondere an dem tiefblauen Platz: Der Unterbau des 99 mal 59 Meter großen Spielfeldes besteht zu einem Fünftel aus CO2-basiertem Kunststoff.
Der Platz wird kein Einzelfall bleiben: Der Sportbodenproduzent Polytan gehört zur bayerischen Sport Group, dem weltgrößten Hersteller von Kunstrasenplätzen und Laufbahnen. Das Unternehmen will das Verfahren nun für den Bau von Kunstrasenplätzen weltweit einsetzen. Auch andere Chemiekonzerne wie BASF forschen längst an Kunststoffen, in denen CO2 vorkommt. BASF verarbeitet Kohlenstoffdioxid beispielsweise zu Harnstoff für die Kunstdüngerherstellung. Außerdem hat das Unternehmen ein Verfahren entwickelt, bei dem die Superabsorber, die in Windeln den Urin aufnehmen und kapseln, auf CO2 basieren.
Kraftstoffe aus CO2
Vor dem Durchbruch steht auch das Konzept, aus CO2 Kraftstoffe herzustellen. Auch diese werden üblicherweise auf Basis von Erdöl produziert. Gleich mehrere Forschungseinrichtungen und Startups sind dabei, Pilotanlagen zu entwickeln. Weit vorne sind die Schweizer Pioniere Christoph Gebald und Jan Wurzbacher. Sie haben an der ETH Zürich studiert und als Spinoff das Unternehmen Climeworks in Zürich gegründet. Climeworks entwickelt Filteranlagen, die CO2 direkt aus der Umgebungsluft gewinnen. Das Kohlenstoffdioxid kann dann über chemische Reaktionen weiterverarbeitet oder aber in Gewächshäusern als Wachstumsförderer in der Luft eingesetzt werden. Seit 2017 filtert zum Beispiel eine Climeworks Anlage in Hinwil in der Schweiz jährlich 900 Tonnen CO2 aus der Luft. Das Gas dient als Rohstoff für die Herstellung von Kraftstoffen und für die Getränkeindustrie (Kohlensäure).
Eine Solaranlage von einem Quadratkilometer Fläche könnte pro Tag 20.000 Liter Kerosin produzieren.
Jetzt will Climeworks gemeinsam mit anderen Unternehmen wie Sunfire (Elektrolyse), Ineratec (Synthesetechnik) und EDL Anlagenbau (Umwandlung der Kohlenwasserstoffe zu Kerosin) auf dem Gelände des Flughafens Rotterdam eine Demonstrationsanlage zur Produktion von erneuerbarem Kerosin bauen – die eines Tages klimaneutrales Fliegen ermöglichen könnte. Große Ventilatoren sollen das CO2 aus der Umgebungsluft des Flughafens filtern. Ein Solarfeld liefert Energie für die Elektrolyse, um ein Synthesegas herzustellen, aus dem synthetische Kohlenwasserstoffe gewonnen werden – die Basis für Kerosin. Im Herbst 2019 wird Climeworks dem Flughafen eine Machbarkeitsstudie vorlegen, bis 2021 soll die Anlage in Betrieb gehen.
Energie aus dem Spiegel
Einen etwas anderen Weg gehen die Forscher der ETH Zürich gemeinsam mit ihren Kollegen vom Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) in Köln. Nachdem es ihnen gelungen war, im Labor Kerosin aus CO2 herzustellen, stellten sie im Juni 2019 eine deutlich größere „Sun to Liquid“ Forschungsanlage in Móstoles (Spanien) vor. Diese kann einen halben Liter Kerosin am Tag produzieren. „Das ist ein Durchbruch, weil die Technik auch in größerem Rahmen funktioniert“, sagt Professor Christian Sattler, Experte für Solare Verfahrenstechnik am DLR. „Die Ergebnisse werden wir nutzen, um die Technologie weiterzuentwickeln.“ Der Unterschied zur Technik von Climeworks und Sunfire: Die Reaktionsenergie wird nicht durch Solarstrom erzeugt, sondern durch 169 Spiegel, die Sonnenlicht auf den Reaktor konzentrieren. Nach Einschätzung der Forscher könnte eine Solaranlage von einem Quadratkilometer Fläche pro Tag 20.000 Liter Kerosin produzieren.
Die Herstellung von Kraftstoffen aus CO2 ist für Professor Sattler eine vielversprechende Möglichkeit, um die CO2-Belastung in der Atmosphäre zu senken. Und so könnte aus Kohlenstoffdioxid doch noch ein Segen werden. Als Rohstoff.
Dieser Beitrag stammt aus unserem Unternehmensmagazin „ESSENTIAL“, in dem wir kontinuierlich über Trends und Schwerpunktthemen aus unseren Zielindustrien und -märkten berichten. Weitere Beiträge des Magazins finden Sie hier.
Weitere Storys zum Thema Nachhaltigkeit

Join Us!
Freudenberg Sealing Technologies, seine Produkte und Serviceangebote in Wort und bewegten Bildern erleben, sich mit Mitarbeitenden und Stakeholdern vernetzen und dabei wertvolle geschäftliche Kontakte knüpfen.
Auf LinkedIn vernetzen! open_in_new